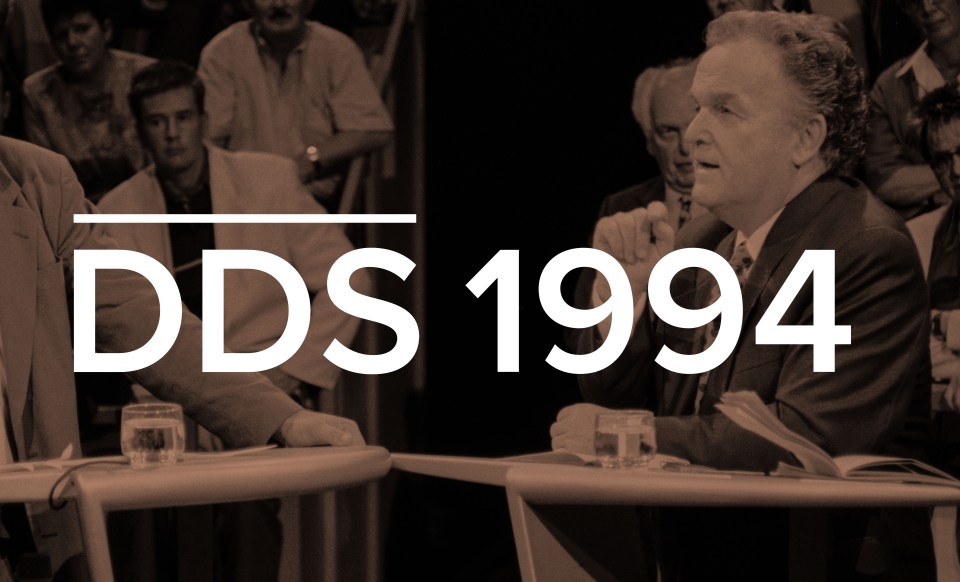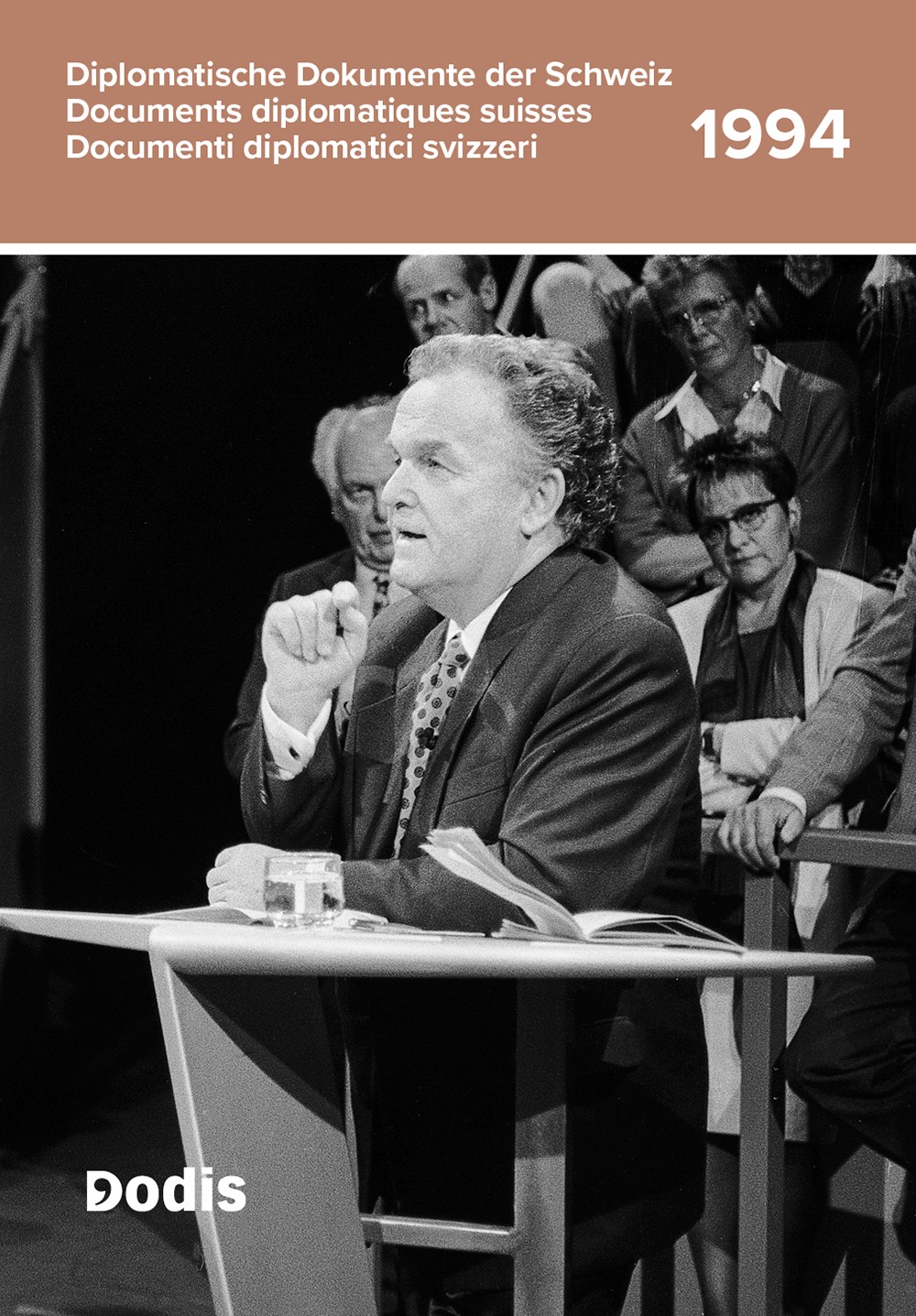Pünktlich zum Jahresauftakt präsentiert die Forschungsstelle Dodis ihre Forschungen zu den internationalen Beziehungen der Schweiz im Jahr 1994. Dodis hat fast einen Kilometer Akten aus dem Schweizerischen Bundesarchiv ausgewertet. Am 1. Januar 2025 veröffentlicht die Forschungsstelle nun eine Auswahl von besonders aussagekräftigen Dokumenten in der Datenbank Dodis und in ihrer neusten Aktenedition – just nach Ablauf ihrer gesetzlichen Schutzfrist. Im Fokus stehen die vertraulichen Verhandlungen mit der EU über sektorielle bilaterale Abkommen, die sicherheitspolitische Zusammenarbeit in Europa sowie die Intensivierung der globalen Wirtschaftskontakte. «Die Akten zum Jahr 1994 zeigen symptomatisch, wie Innen- und Aussenpolitik in der Schweiz aufs Engste miteinander verzahnt sind», sagt Dodis-Direktor Sacha Zala. «Das Nein zum EWR 1992 sollte kein Einzelfall bleiben.»
Verkehrspolitische Wendung
Dass die Schweizer Aussenpolitik mit dem Volk zu rechnen hat, zeigte sich 1994 in einer ganzen Reihe von Abstimmungen. Zu Jahresbeginn machten Stimmbürgerinnen und Stimmbürger dem Bundesrat mit der Annahme der Alpen-Initiative einen Strich nicht nur durch die verkehrs- sondern auch durch die aussenpolitische Rechnung. Die abrupte Wendung in der schweizerischen Transitpolitik sorgte in Brüssel für erhebliche Irritation. Der Bundesrat versuchte zu beschwichtigen, dass die Schweiz ihren Verpflichtungen trotz der Initiative «zum Schutze des Alpengebiets vor dem Transitverkehr» nachkommen werde (dodis.ch/64665) und legte bereits im September eine europakonforme Lösung vor. Der Verkehrsbereich blieb aber weiterhin im Mittelpunkt des Interesses, nicht nur in den Verhandlungen mit der EU sondern auch in den Medien und an den schweizerischen Stammtischen (dodis.ch/68436).
Bundesrat in der Vertrauenskrise?
Im Juni scheiterten sowohl eine schweizerische Beteiligung an den Blauhelmen der UNO, als auch der Kulturförderungsartikel und die erleichterte Einbürgerung für junge Ausländerinnen und Ausländer an der Urne. Nach dieser krachenden Abstimmungsniederlage sah der Bundesrat weit mehr als seinen grundsätzlichen Kurs hinterfragt: Ein wahrhaftiger Vertrauensverlust in eine «nicht immer führungsstarke» Regierung und die Spaltung des Landes wurde diagnostiziert. Der Bundesrat sei aber durchaus fähig, seine Politik zu verteidigen. Dafür, so Bundesrat Ogi, sollte die Aussenpolitik der Schweiz verstärkt in der Innenpolitik verankert werden (dodis.ch/67773). Die Zusammenarbeit im Rat sowie die Einhaltung der Konkordanz blieben übers ganze Jahr hinweg ein Thema und wurden Bestandteil einer weiteren Klausur Ende Jahr (dodis.ch/67782).
«Klarer Wein» statt «Wischiwaschi»
Schweizer Aussenpolitik in den 1990er Jahren, was sollte das sein? Dazu nahm der Bundesrat in einem Grundlagenpapier Stellung, das 1994 im Parlament ausführlich diskutiert wurde. Dem Bundesrat sei daran gelegen, «klaren Wein» einzuschenken und kein «verworrenes Wischiwaschi» zu präsentieren. Letztlich gehe es darum darzulegen, dass es bei der Aussenpolitik «um wesentliche Interessen des Schweizervolkes» gehe, Volksentscheide hätten «die Geschichte des Landes nie gestoppt» (dodis.ch/66378). Das wusste auch Bundespräsident Stich, als er in der Sendung «Arena» des Schweizer Fernsehens das Wort ergriff und das Antirassismus-Gesetz verteidigte, gegen welches das Referendum ergriffen worden war (dodis.ch/68546). Im Gegensatz zu diversen Volksentscheiden im Jahr 1994 sollte die Regierung die Abstimmung zum Beitritt der Schweiz zur Antirassismuskonvention der UNO zwar gewinnen. «Das Jahr 1994 führte dem Bundesrat aber eindrücklich vor Augen, welch starkem Gegenwind sein aussenpolitischer Kurs ausgesetzt war», stellt von Dodis-Direktor Sacha Zala fest.
Die forschungsrelevante Auswahl an Dokumenten ist auf www.dodis.ch frei zugänglich.
→ Zum Band DDS 1994
Zum Band DDS 1994
Zur Vernissage vom 3. Januar 2025